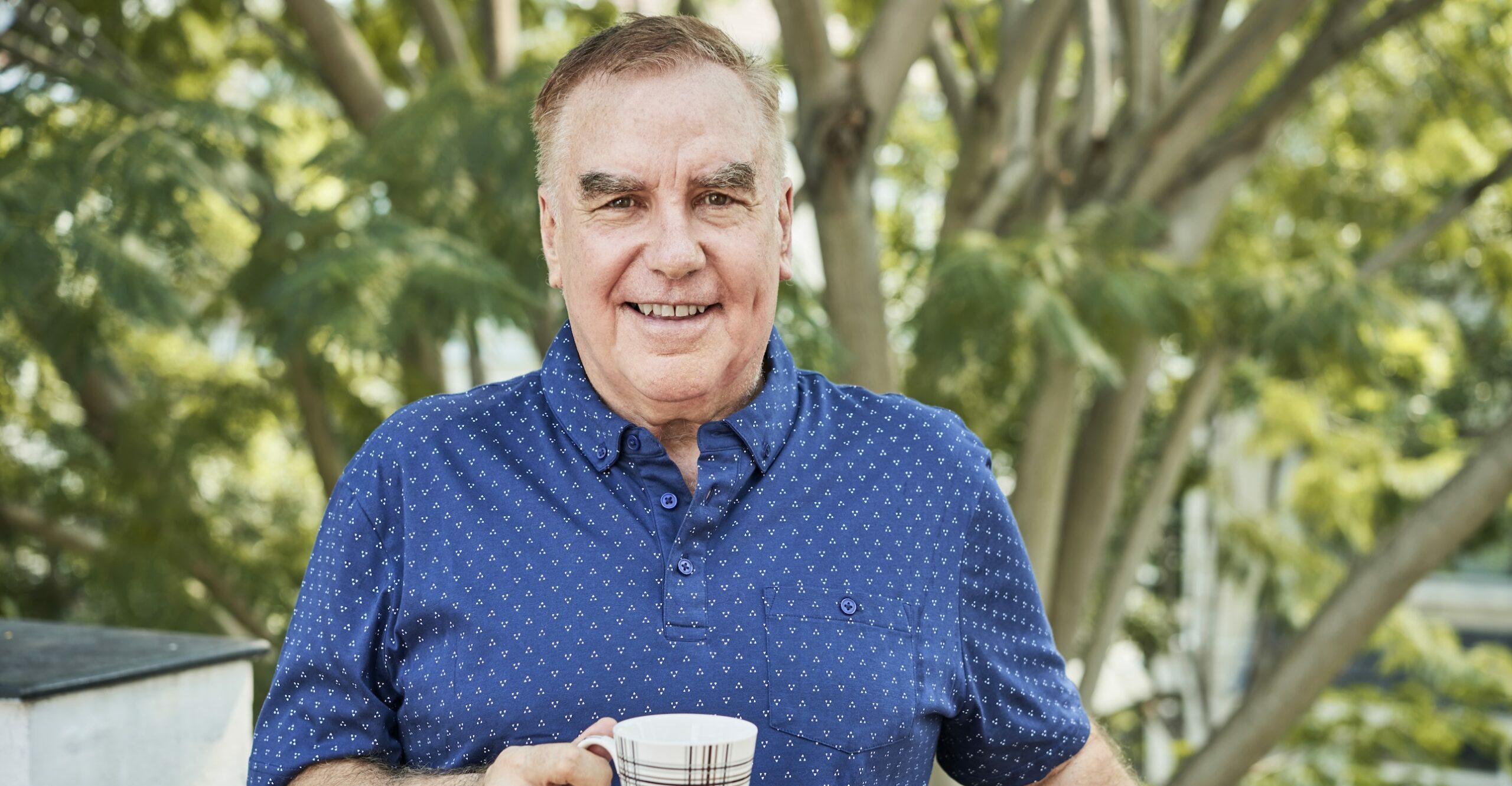Was die Antidiskriminierungsperspektive deutlich macht, ist der Einfluss des „Norm-Bürgers“, der in vielen Annahmen und Politiken mitschwingt. Dieser „Norm-Bürger“ beschreibt einen mittelalten, gesunden, weißen Mann mit deutschem Pass und gutem Job, der kaum oder gar keine Haus- und Fürsorgearbeit leisten muss. Es ist offensichtlich, dass der Großteil der Bevölkerung von dieser Norm abweicht oder diese Norm nicht mehr erfüllen will. Trotzdem bleibt diese Norm oft der unbewusste Ausgangspunkt für viele Praktiken, Gesetze, Abläufe, Gebäudeplanungen und alltägliche Anforderungen.
Diese zum Teil auch unreflektierte Orientierung am „Norm-Bürger“ führt an vielen Stellen zu Ausschlüssen, weil andere Perspektiven und Erfahrungen weniger beachtet werden. Das zeigt sich zum Beispiel in der Einkommens- und Rentenstruktur, die auf dem „Vollzeit Alleinverdiener“ basiert, der eine durchgehende Berufslaufbahn und fließende Deutschkenntnisse hat. Ebenso zeigt es sich in der Idee einer „Normalarbeitszeit“ von acht Stunden täglich, was für Menschen, die sich um Wohnung, Kinder und Angehörige kümmern müssen, unrealistisch ist, da Fürsorgearbeit nicht weniger als 2-4 Stunden täglich einnimmt. Oder auch in der Autogestaltung, die sich nur an männlichen Dummys mit bestimmtem Körperbau orientiert. Auch viele Gebäude haben ein paar Stufen am Eingang, was für Menschen im Rollstuhl eine schwer zu überwindende Barriere darstellt.
Um Ausschlüsse zu vermeiden und Chancen für alle zu schaffen, muss die Orientierung an dieser Norm zunächst hinterfragt und dann verändert werden. Viele Beispiele lassen sich finden, aber oft fällt uns das gar nicht auf, weil wir mit dieser „unsichtbaren“ Norm aufgewachsen sind. Wir sehen uns selbst als „Abweichung“, wenn wir zum Beispiel nur Teilzeit arbeiten oder mehrmals den Job wechseln müssen, weil unsere Ausbildung von woanders hier nicht anerkannt wird.
Es sind mühsame Prozesse, diese Norm zu reflektieren und zu verändern. Das bedeutet auch, dass wir unsere eigenen Privilegien betrachten und hinterfragen müssen. Außerdem gibt es viele blinde Flecken, die uns und anderen erst bewusst gemacht werden müssen, damit wir Ausschlüsse und Diskriminierung erkennen und ändern können.